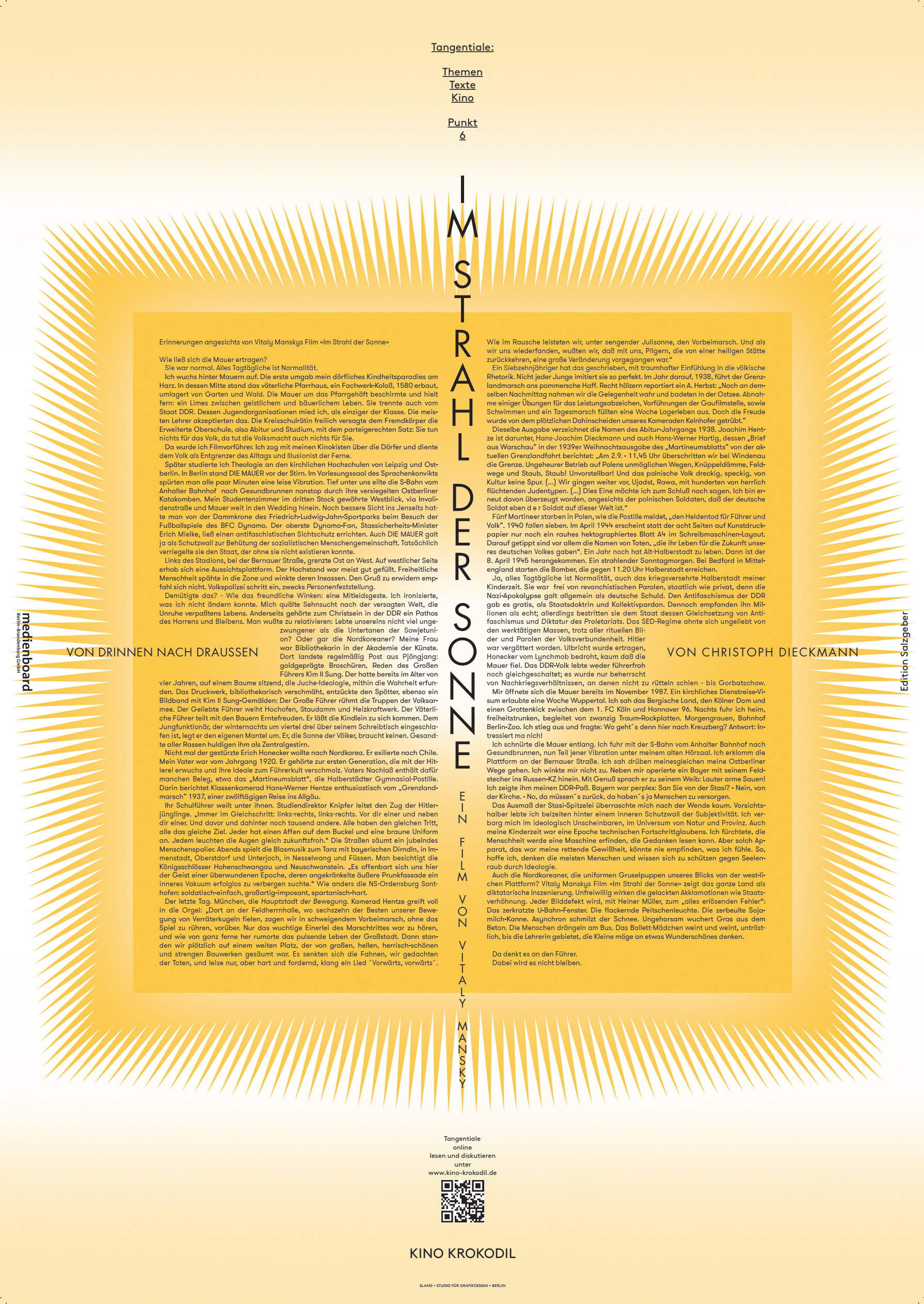Erinnerungen angesichts von Vitaly Manskys Film „Im Strahl der Sonne“
Essay von Christoph Dieckmann
Wie ließ sich die Mauer ertragen?
Sie war normal. Alles Tagtägliche ist Normalität.
Ich wuchs hinter Mauern auf. Die erste umgab mein dörfliches Kindheitsparadies am Harz. In dessen Mitte stand das väterliche Pfarrhaus, ein Fachwerk-Koloß, 1580 erbaut, umlagert von Garten und Wald. Die Mauer um das Pfarrgehöft beschirmte und hielt fern: ein Limes zwischen geistlichem und bäuerlichem Leben. Sie trennte auch vom Staat DDR. Dessen Jugendorganisationen mied ich, als einziger der Klasse. Die meisten Lehrer akzeptierten das. Die Kreisschulrätin freilich versagte dem Fremdkörper die Erweiterte Oberschule, also Abitur und Studium, mit dem parteigerechten Satz: Sie tun nichts für das Volk, da tut die Volksmacht auch nichts für Sie.
Da wurde ich Filmvorführer. Ich zog mit meinen Kinokisten über die Dörfer und diente dem Volk als Entgrenzer des Alltags und Illusionist der Ferne.
Später studierte ich Theologie an den kirchlichen Hochschulen von Leipzig und
Ostberlin. In Berlin stand DIE MAUER vor der Stirn. Im Vorlesungssaal des Sprachenkonvikts spürten man alle paar Minuten eine leise Vibration. Tief unter uns eilte die S‑Bahn vom Anhalter Bahnhof nach Gesundbrunnen nonstop durch ihre versiegelten Ostberliner Katakomben. Mein Studentenzimmer im dritten Stock gewährte Westblick, via Invalidenstraße und Mauer weit in den Wedding hinein. Noch bessere Sicht ins Jenseits hatte man von der Dammkrone des Friedrich-Ludwig- Jahn-Sportparks beim Besuch der Fußballspiele des BFC Dynamo. Der oberste Dynamo-Fan, Staatssicherheits-Minister Erich Mielke, ließ einen antifaschistischen Sichtschutz errichten. Auch DIE MAUER galt ja als Schutzwall zur Behütung der sozialistischen Menschengemeinschaft. Tatsächlich verriegelte sie den Staat, der ohne sie nicht existieren konnte.
Links des Stadions, bei der Bernauer Straße, grenzte Ost an West. Auf westlicher Seite erhob sich eine Aussichtsplattform. Der Hochstand war meist gut gefüllt. Freiheitliche Menschheit spähte in die Zone und winkte deren Insassen. Den Gruß zu erwidern empfahl sich nicht. Volkspolizei schritt ein, zwecks Personenfeststellung.
Demütigte das? – Wie das freundliche Winken: eine Mitleidsgeste. Ich ironisierte, was ich nicht ändern konnte. Mich quälte Sehnsucht nach der versagten Welt, die Unruhe verpaßtens Lebens. Anderseits gehörte zum Christsein in der DDR ein Pathos des Harrens und Bleibens. Man wußte zu relativieren: Lebte unsereins nicht viel ungezwungener als die Untertanen der Sowjetunion? Oder gar die Nordkoreaner? Meine Frau war Bibliothekarin in der Akademie der Künste. Dort landete regelmäßig Post aus Pjöngjang: goldgeprägte Broschüren, Reden des Großen Führers Kim Il Sung. Der hatte bereits im Alter von vier Jahren, auf einem Baume sitzend, die Juche-Ideologie, mithin die Wahrheit erfunden. Das Druckwerk, bibliothekarisch verschmäht, entzückte den Spötter, ebenso ein Bildband mit Kim Il Sung-Gemälden: Der Große Führer rühmt die Truppen der Volksarmee. Der Geliebte Führer weiht Hochofen, Staudamm und Heizkraftwerk. Der Väterliche Führer teilt mit den Bauern Erntefreuden. Er läßt die Kindlein zu sich kommen. Dem Jungfunktionär, der winternachts um viertel drei über seinem Schreibtisch eingeschlafen ist, legt er den eigenen Mantel um. Er, die Sonne der Völker, braucht keinen. Gesandte aller Rassen huldigen ihm als Zentralgestirn. Nicht mal der gestürzte Erich Honecker wollte nach Nordkorea. Er exilierte nach Chile.
Mein Vater war vom Jahrgang 1920. Er gehörte zur ersten Generation, die mit der Hitlerei erwuchs und ihre Ideale zum Führerkult verschmolz. Vaters Nachlaß enthält dafür manchen Beleg, etwa das „Martineumsblatt“, die Halberstädter Gymnasial- Postille. Darin berichtet Klassenkamerad Hans-Werner Hentze enthusiastisch vom „Grenzlandmarsch“ 1937, einer zwölftägigen Reise ins Allgäu.
Ihr Schulführer weilt unter ihnen. Studiendirektor Knipfer leitet den Zug der Hitlerjünglinge. „Immer im Gleichschritt: links-rechts, links-rechts. Vor dir einer und neben dir einer. Und davor und dahinter noch tausend andere. Alle haben den gleichen Tritt, alle das gleiche Ziel. Jeder hat einen Affen auf dem Buckel und eine braune Uniform an. Jedem leuchten die Augen gleich zukunftsfroh.“ Die Straßen säumt ein jubelndes Menschenspalier. Abends spielt die Blasmusik zum Tanz mit bayerischen Dirndln, in Immenstadt, Oberstdorf und Unterjoch, in Nesselwang und Füssen. Man besichtigt die Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein. „Es offenbart sich uns hier der Geist einer überwundenen Epoche, deren angekränkelte äußere Prunkfassade ein inneres Vakuum erfolglos zu verbergen suchte.“ Wie anders die NS-Ordensburg Sonthofen: soldatisch-einfach, großartig- imposant, spartanisch-hart.
Der letzte Tag. München, die Hauptstadt der Bewegung. Kamerad Hentze greift voll in die Orgel: „Dort an der Feldherrnhalle, wo sechszehn der Besten unserer Bewegung von Verräterkugeln fielen, zogen wir in schweigendem Vorbeimarsch, ohne das Spiel zu rühren, vorüber. Nur das wuchtige Einerlei des Marschtrittes war zu hören, und wie von ganz ferne her rumorte das pulsende Leben der Großstadt. Dann standen wir plötzlich auf einem weiten Platz, der von großen, hellen, herrisch- schönen und strengen Bauwerken gesäumt war. Es senkten sich die Fahnen, wir gedachten der Toten, und leise nur, aber hart und fordernd, klang ein Lied ́Vorwärts, vorwärts ́. Wie im Rausche leisteten wir, unter sengender Julisonne, den Vorbeimarsch. Und als wir uns wiederfanden, wußten wir, daß mit uns, Pilgern, die von einer heiligen Stätte zurückkehren, eine große Veränderung vorgegangen war.“
Ein Siebzehnjähriger hat das geschrieben, mit traumhafter Einfühlung in die völkische Rhetorik. Nicht jeder Junge imitiert sie so perfekt. Im Jahr darauf, 1938, führt der Grenzlandmarsch ans pommersche Haff. Recht hölzern reportiert ein A. Herbst: „Noch an demselben Nachmittag nahmen wir die Gelegenheit wahr und badeten in der Ostsee. Abnahme einiger Übungen für das Leistungsabzeichen, Vorführungen der Gaufilmstelle, sowie Schwimmen und ein Tagesmarsch füllten eine Woche Lagerleben aus. Doch die Freude wurde von dem plötzlichen Dahinscheiden unseres Kameraden Kelnhofer getrübt.“
Dieselbe Ausgabe verzeichnet die Namen des Abitur-Jahrgangs 1938. Joachim Hentze ist darunter, Hans-Joachim Dieckmann und auch Hans-Werner Hartig, dessen „Brief aus Warschau“ in der 1939er Weihnachtsausgabe des „Martineumsblatts“ von der aktuellen Grenzlandfahrt berichtet: „Am 2.9. – 11,45 Uhr überschritten wir bei Windenau die Grenze. Ungeheurer Betrieb auf Polens unmöglichen Wegen, Knüppeldämme, Feldwege und Staub, Staub! Unvorstellbar! Und das polnische Volk dreckig, speckig, von Kultur keine Spur. (…) Wir gingen weiter vor, Ujadst, Rawa, mit hunderten von herrlich flüchtenden Judentypen. (…) Dies Eine möchte ich zum Schluß noch sagen. Ich bin erneut davon überzeugt worden, angesichts der polnischen Soldaten, daß der deutsche Soldat eben d e r Soldat auf dieser Welt ist.“
Fünf Martineer starben in Polen, wie die Postille meldet, „den Heldentod für Führer und Volk“. 1940 fallen sieben. Im April 1944 erscheint statt der acht Seiten auf Kunstdruckpapier nur noch ein rauhes hektographiertes Blatt A4 im Schreibmaschinen-Layout. Darauf getippt sind vor allem die Namen von Toten, „die ihr Leben für die Zukunft unseres deutschen Volkes gaben“. Ein Jahr noch hat Alt- Halberstadt zu leben. Dann ist der 8. April 1945 herangekommen. Ein strahlender Sonntagmorgen. Bei Bedford in Mittelengland starten die Bomber, die gegen 11.20 Uhr Halberstadt erreichen.
Ja, alles Tagtägliche ist Normalität, auch das kriegsversehrte Halberstadt meiner Kinderzeit. Sie war frei von revanchistischen Parolen, staatlich wie privat, denn die Nazi-Apokalypse galt allgemein als deutsche Schuld. Den Antifaschismus der DDR gab es gratis, als Staatsdoktrin und Kollektivpardon. Dennoch empfanden ihn Millionen als echt; allerdings bestritten sie dem Staat dessen Gleichsetzung von Antifaschismus und Diktatur des Proletariats. Das SED-Regime ahnte sich ungeliebt von den werktätigen Massen, trotz aller rituellen Bilder und Parolen der Volksverbundenheit. Hitler war vergöttert worden. Ulbricht wurde ertragen, Honecker vom Lynchmob bedroht, kaum daß die Mauer fiel. Das DDR-Volk lebte weder führerfroh noch gleichgeschaltet; es wurde nur beherrscht von Nachkriegsverhältnissen, an denen nicht zu rütteln schien – bis Gorbatschow.
Mir öffnete sich die Mauer bereits im November 1987. Ein kirchliches Dienstreise- Visum erlaubte eine Woche Wuppertal. Ich sah das Bergische Land, den Kölner Dom und einen Grottenkick zwischen dem 1. FC Köln und Hannover 96. Nachts fuhr ich heim, freiheitstrunken, begleitet von zwanzig Traum-Rockplatten. Morgengrauen, Bahnhof Berlin-Zoo. Ich stieg aus und fragte: Wo geht ́s denn hier nach Kreuzberg? Antwort: Intressiert ma nich!
Ich schnürte die Mauer entlang. Ich fuhr mit der S‑Bahn vom Anhalter Bahnhof nach Gesundbrunnen, nun Teil jener Vibration unter meinem alten Hörsaal. Ich erklomm die Plattform an der Bernauer Straße. Ich sah drüben meinesgleichen meine Ostberliner Wege gehen. Ich winkte mir nicht zu. Neben mir operierte ein Bayer mit seinem Feldstecher ins Russen-KZ hinein. Mit Genuß sprach er zu seinem Weib: Lauter arme Sauen! Ich zeigte ihm meinen DDR-Paß. Bayern war perplex: San Sie von der Stasi? – Nein, von der Kirche. – No, da müssen ́s zurück, da haben ́s ja Menschen zu versorgen.
Das Ausmaß der Stasi-Spitzelei überraschte mich nach der Wende kaum. Vorsichtshalber lebte ich beizeiten hinter einem inneren Schutzwall der Subjektivität. Ich verbarg mich im ideologisch Unscheinbaren, im Universum von Natur und Provinz. Auch meine Kinderzeit war eine Epoche technischen Fortschrittglaubens. Ich fürchtete, die Menschheit werde eine Maschine erfinden, die Gedanken lesen kann. Aber solch Apparat, das war meine rettende Gewißheit, könnte nie empfinden, was ich fühle. So, hoffe ich, denken die meisten Menschen und wissen sich zu schützen gegen Seelenraub durch Ideologie.
Auch die Nordkoreaner, die uniformen Gruselpuppen unseres Blicks von der westlichen Plattform? Vitaly Manskys Film „Im Strahl der Sonne“ zeigt das ganze Land als diktatorische Inszenierung. Unfreiwillig wirken die gelackten Akklamationen wie Staatsverhöhnung. Jeder Bilddefekt wird, mit Heiner Müller, zum „alles erlösenden Fehler“: Das zerkratzte U‑Bahn-Fenster. Die flackernde Peitschenleuchte. Die zerbeulte Sojamilch-Kanne. Asynchron schmilzt der Schnee. Ungehorsam wuchert Gras aus dem Beton. Die Menschen drängeln am Bus. Das Ballett-Mädchen weint und weint, untröstlich, bis die Lehrerin gebietet, die Kleine möge an etwas Wunderschönes denken.
Da denkt es an den Führer.
Dabei wird es nicht bleiben.